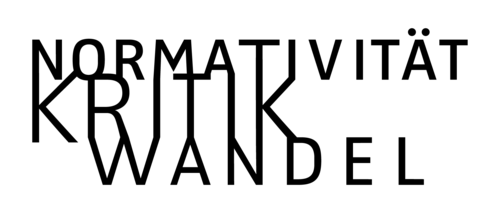Isabel Mehl

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Altensteinstr. 15
14195 Berlin
Isabel Mehl ist Kunstwissenschaftlerin, freie Autorin und Kunstkritikerin und lebt in Berlin. Ihre Texte wurden u.a. in frieze und Texte zur Kunst veröffentlicht. Zu ihren aktuellen Interessengebieten gehören die Überschneidung von Kritik und Fiktion, Museumsszenerien in Gemälde/Film, die Kunstkritikerin als Sozialfigur, „Autofiktion“ (in Ermangelung eines besseren Begriffs) sowie Selbstporträts von Künstlerinnen. Sie studierte Medienwissenschaft, Kunstwissenschaft, Medienphilosophie und Medienkunst in Marburg, Oslo, Karlsruhe und New York. Ihre Promotion über die fiktive Kunstkritikerin Madame Realism, die von der Autorin und Kulturkritikerin Lynne Tillman in den 1980er Jahren erschaffen wurde, schloss sie 2020 als Doktorandin des Graduiertenkollegs "Kulturen der Kritik" an der Leuphana Universität Lüneburg ab. Von 2021 bis Anfang 2023 war sie Postdoc an der Ruhr-Universität Bochum. Seit April 2023 ist sie am Graduiertenkolleg "Normativität - Kritik - Wandel" an der FU Berlin tätig.
Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit war sie 2012 Gründungsmitglied des Feministischen Arbeitskollektivs (FAK) in Karlsruhe sowie Mitherausgeberin von deren Zeitschrift „Body of Work“ (2015). Seit 2016 kollaboriert sie mit der Kunsthistorikerin Oona Lochner unter dem Label „From Where I Stand: Feminist Art/Writing. Subjektivitäten, Genealogien und Kritik“. Sie geben Schreibworkshops, schreiben kollaborativ und haben auch gemeinsam Vorträge gehalten. Sie realisierte in unterschiedlichen personellen Konstellationen mehrere Hörspiele (Deutschlandfunk Kultur, WDR) sowie Kurzfilme, zuletzt „Agentin des Zweifels“ (2022) zusammen mit der Künstlerin Alina Schmuch.
Das ist kein Liebesbrief. Zum Briefmotiv in der Malerei
Der Brief wird in der europäischen Malerei meist als eine weiß schattierte Fläche dargestellt, das Geschriebene ist in der Regel nicht zu entziffern. Auf diese Weise zieht das Briefmotiv die Aufmerksamkeit der Betrachter:innen in besonderer Weise auf sich: der Brief stellt das ihm innewohnende Geheimnis aus und verbirgt es zugleich. Daraus ergibt sich die stetige Notwendigkeit den Brief bei der Betrachtung zu aktualisieren: er verkörpert eine Lücke, etwas nicht Eindeutiges, das mit Bedeutung „befüllt“ wird und sich diesen Zuschreibungen zugleich entzieht. In diesem Spannungsverhältnis liegt das Potential sich die normative Durchdringung der Bildlektüren bewusst zu machen. Der Brief funktioniert als Kondensationsmoment, der die Abhängigkeit der Kunstbetrachtung von der Situiertheit der Betrachtenden darstellt.
Historisch betrachtet ist das Briefmotiv unmittelbar an die Briefleserin (selten die Briefschreiberin) geknüpft. Zahlreiche Briefe empfangende und lesende Frauen sind in der Kunstgeschichte zu finden. Im 17. Jh. wurde das Briefmotiv in der holländischen Malerei omnipräsent und der Brief synonym mit dem Liebesbrief. Öffnet sich der Blick über das 17. Jahrhundert hinaus (Fokus 19./20. Jh), weitet sich auch das Verständnis des Briefobjektes selbst, dessen Rätsel sich weniger eindeutig den Liebesverwicklungen der dargestellten Personen zuschreiben lässt.
So unbeschrieben wie das weiße Blatt zunächst erscheint, ist es jedenfalls nicht. So stellt sich schließlich die Frage, ob sich das Briefmotiv tatsächlich als Ausdruck einer Geste des Entzugs (die Worte werden unsichtbar gehalten) lesen lässt: Ist es ein Entzug an Informationen oder eine Verschiebung des Fokus hin zur Reflexion des eigenen Blicks auf die Kunst? Und wie verändert sich der Blick in einer Zeit in der die Kulturtechnik des Briefs für den privaten Austausch kaum noch eine Rolle zu spielen scheint und einzelne Länder (z.B. Dänemark) die Briefzustellung einstellen? Welche Funktion erfüllt das Briefmotiv in den jeweiligen Werken? Inwiefern thematisieren die Werke die Klassen- oder Geschlechterverhältnisse? Welche kulturellen Spezifika lassen sich in den Briefszenen beschreiben? Worin liegt die Spezifik des Briefmotivs in seiner Verwendung von Künstlerinnen?
Monographien
Im Zeichen des Zweifel(n)s: Madame Realism oder: Die Funktion der Fiktion in der Kunstkritik, edition metzel, München, 2022.
Rezension von Kathrin Heinrich, springerin 02/2023: https://www.springerin.at/2023/2/lektuere/iim-zeichen-des-zweifelns-madame-realism-oder-die-funktion-der-fiktion-in-der-kunstkritiki/
Herausgaben
Critique: The Stakes of Form, Sami Khatib, Holger Kuhn, Oona Lochner, Isabel Mehl, Beate Söntgen (Hrsg.), diaphanes, Zürich / Berlin, 2020.
Body of Work, Munitionsfabrik #24, Feministisches Arbeitskollektiv (Hrsg.), Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, 2015.
Aufsätze/Kunstkritik (Auswahl)
Der Selbstporträtfilter. Künstlerinnen und die Biografiefalle. Expressionismus, Selbstporträts 20/2024, Hg. Herausgegeben von Kristin Eichhorn, Johannes S. Lorenzen, Berlin: Neofelis, 14-28. – Besprechung im Deutschlandfunk Kultur: https://www.deutschlandfunk.de/kristin-eichborn-ueber-selbstportraets-heft-20-der-zeitschrift-expressionismus-100.html
Korrespondenzen, Rezension von Gabriele Münter im Bucerius Kunst Forum, Hamburg, S. 187–191, in: Texte zur Kunst, September 2023.
Lässig an der Schnellstrasse stehen. Eine tagesfomabhängige Kritik von „Sibylle Bergemann. Stadt Land Hund. Fotografien 1966–2010“ in der Berlinischen Galerie mit einem Echo aus den Aufzeichnungen der britischen Kunsttheoretikerin Vernon Lee; in: Ins Bild kommen – Spielräume der Kunstkritik, Anita Hosseini, Anna Kipke, Holger Kuhn, Mimmi Woisnitza (Hrsg.), Brill Fink Verlag, 2023.
Interview with German Art Historians Oona Lochner and Isabel Mehl by Sharon Hecker and Catherine Ramsey-Portolano: Writing Like a Feminist—in Dialogue with Carla Lonzi, S. 383–395 ; in: Female Cultural Production in Modern Italy, Sharon Hecker, Catherine Ramsey-Portolano (Hrsg.), Palgrave, London, 2023.
How Bad Was He? Let Me Count the Ways: Auguste Renoir and His Critics of the 1980s. Isabel Mehl and Beate Söntgen in conversation, mit Beate Söntgen, S. 283–307; in: Stephanie Marchal, Beate Söntgen, Hubert Locher, Melanie Sachs, Elisabeth Heymer (Hrsg.): Judgment Practices in the Artistic Field, Edition Metzel, München, 2022.
A Drifting Mind, zu Lynne Tillman’s „The Matisse Pages from Madame Realism’s Diary“, S. 284; in: Why Art Criticism?, Beate Söntgen, Julia Voss (Hrsg.), Hatje Cantz, Berlin, 2022.
Lonzi Lesen, mit Oona Lochner, S. 179-189; in: Selbstbewusstwerdung. Schriften zu Kunst und Feminismus von Carla Lonzi, Giovanna Zapperi (Hrsg.), bbooks, Berlin, 2021.
Short Cuts, über Faux Pas. Selected Writings and Drawings (2020) von Amy Sillman, Texte zur Kunst, Berlin, Januar 2021: https://www.textezurkunst.de/articles/isabel-mehl-short-cuts/
Feedback Systems. Artwriting as Critique?, S. 175–183; in: Critique: The Stakes of Form, Sami Khatib, Holger Kuhn, Oona Lochner, Isabel Mehl, Beate Söntgen (Hrsg.), diaphanes, Zürich / Berlin, 2020 (Peer-Reviewed).
On Slowing Down and Not Being Shy. A Conversation Between Chris Kraus and Isabel Mehl, S. 185–196; in: Critique: The Stakes of Form, Sami Khatib, Holger Kuhn, Oona Lochner, Isa- bel Mehl, Beate Söntgen (Hrsg.), diaphanes, Zürich / Berlin, 2020 (Peer-Reviewed).
Blind Spots on the Move, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Februar 2020: https://newal- phabetschool.hkw.de/blind-spots-on-the-move/
Die Ich-Funktion, Texte zur Kunst, Berlin, September 2019: https://www.textezurkunst.de/ articles/die-ich-funktion/
Poetische Sezierungen, S. 214–217; in: Texte zur Kunst, Heft Nr. 115, Berlin, September 2019.
Why Is Kathy Acker So Maddeningly Difficult to Memorialize?, frieze, London, April 2019: https://www.frieze.com/article/why-kathy-acker-so-maddeningly-difficult-memorialize
Lynne Tillman’s Critical Fictions. Fragments from an Encounter between Isabel Mehl and Lynne Tillman, S. 98–107; in: PROVENCE Report, Spector Books, Leipzig, Herbst/Winter, 2018/19.
Travelling to Greece. A Written Correspondence, mit Oona Lochner, Brand New Life Maga- zine, Zürich, 2018: https://brand-new-life.org/b-n-l/travelling-to-greece-en-us/
„Überlast“ und Emanzipation. Ich weiss nicht, ob mein Stand es erlaubt, S. 210–214; in: Tex- te zur Kunst, Heft Nr. 108, Berlin, Dezember 2017.
A Collaborative Glossary / From Where I Stand, mit Laura Kowalewski und Oona Loch- ner, Feministische Studien, Berlin, August 2017: https://blog.feministische-studien. de/2017/08/a-collaborative-glossary-from-where-i-stand.
#ilovedick – Selfies mit Textreferenz, Pop. Kultur und Kritik, Siegen, Juni 2017: https://pop- zeitschrift.de/2017/06/16/social-media-junivon-isabel-mehl16-6-2017/
„Stell‘ Dir einmal vor wie schön das wäre...“, Isabel Mehl im Gespräch mit Tatjana Turanskyj, Body of Work, Karlsruhe, 2015.